...powered by
freaks-at-work
freaks-at-work
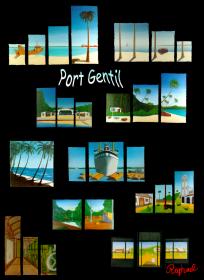
In der Nacht zum 27. Mai entlud sich die gesamte angestaute Energie der letzten drei Sonnentage in einem zornigen Gewitter. Ich erwachte durch das wüste Schlingern. Es heulte und schepperte. Töpfe flogen in der Kombüse herum. Blitze zuckten durch die skylights, gefolgt von hämmernden Donnerschlägen. Das Atmen fiel schwer. Es fing an zu regnen. Durch das Stampfen kam sehr viel Wasser ins Schiff. Flutwellen rollten über Deck und strudelten klatschend durch den Hauptniedergang. Die Golden Harvest stöhnte jedes Mal auf, wenn sie eintauchte. Es knarrte und knirschte.
An Deck waren Stimmen zu hören und Momos Getrampel. Die Zwei hatten Schwierigkeiten, den Kurs zu halten. Sie blieben hoch am Wind, wollten weder abfallen, noch die Schoten auffieren, um die Fahrt zu verringern. Das Luffen verstärkte sich. Dann gab es auf einmal einen furchtbaren Ruck, begleitet von berstenden Geräuschen. Ich flog aus der Koje, hielt mich am Fockmast fest. An Deck splitterte Holz. Alles war in Bewegung. Es krachte, als würde jemand wild mit einem Prügel um sich schlagen.
Die Golden Harvest war aus dem Ruder gelaufen. Bei dem starken Wind hätte es uns die Masten brechen können. Der Schoner schlingerte, bäumte sich auf, schlug hart ins nächste Wellental und bebte. Durch die Erschütterungen löste sich das Werg zwischen den Planken. Immer mehr Wasser drang ein. Die Bilgen liefen über, obwohl nonstop gepumpt wurde. Momo brüllte Befehle. Er rief nach Morishda und »Elli«. Elli, als Kurzform für Elise.
Ein entsetzlicher Tornado fegte über uns hinweg. Roy hatte in Lomé erklärt, in welcher Beziehung diese Stürme zu den Innertropischen Konvergenzzonen standen. Das klang damals sehr theoretisch. Es brauchte praktische Erfahrung, Poseidon die Locken zu föhnen und einen Gaffelschoner unter vollem Tuch durch einen Wirbelsturm zu steuern. Letztlich war es keine Schande für Momo und Elise, dass ihnen das Schiff immer wieder aus dem Ruder lief. Die Zwei kämpften verzweifelt. Sie brauchten Hilfe. Wir waren zu erschöpft zum Streiten, bargen die Stagsegel, so gut es ging, drehten über das Großsegel bei und fixierten den Baum mit Taljen. Um den Kontakt mit den Meuterern zu vermeiden, blieb ich danach unter Deck, verkeilte mich in der Koje und lauschte den Geräuschen.
Das Schaukeln wurde erträglich. Trotzdem kam weiterhin sehr viel Wasser über, wie in einem schlechten Seeräuberfilm. Momodu lag leergekotzt und fast besinnungslos vor Seekrankheit in der Kammer von Roy, weil man ihn da nicht sehen musste. Hören konnten wir ihn trotzdem. Es war ein höllisches Konzert. Das Rauschen von Wind und Wellen, der prügelnde Donner, das Arbeiten der Holzverbindungen, die Sauggeräusche der Lenzpumpen, die schrille Stimme von Elise, das erbärmliche Würgen unseres shadow-captains, das Getrampel und Momos Geschrei. Da dachte ich: (Ps. 55; 6, 7, 8) Hätte ich Flügel wie eine Taube, ich flöge davon und käme zur Ruhe. Weit fort möchte ich fliehen, die Nacht verbringen in der Wüste. An einen sicheren Ort möchte ich eilen, vor dem Wetter, und vor dem tobenden Sturm.
An Deck waren Stimmen zu hören und Momos Getrampel. Die Zwei hatten Schwierigkeiten, den Kurs zu halten. Sie blieben hoch am Wind, wollten weder abfallen, noch die Schoten auffieren, um die Fahrt zu verringern. Das Luffen verstärkte sich. Dann gab es auf einmal einen furchtbaren Ruck, begleitet von berstenden Geräuschen. Ich flog aus der Koje, hielt mich am Fockmast fest. An Deck splitterte Holz. Alles war in Bewegung. Es krachte, als würde jemand wild mit einem Prügel um sich schlagen.
Die Golden Harvest war aus dem Ruder gelaufen. Bei dem starken Wind hätte es uns die Masten brechen können. Der Schoner schlingerte, bäumte sich auf, schlug hart ins nächste Wellental und bebte. Durch die Erschütterungen löste sich das Werg zwischen den Planken. Immer mehr Wasser drang ein. Die Bilgen liefen über, obwohl nonstop gepumpt wurde. Momo brüllte Befehle. Er rief nach Morishda und »Elli«. Elli, als Kurzform für Elise.
Ein entsetzlicher Tornado fegte über uns hinweg. Roy hatte in Lomé erklärt, in welcher Beziehung diese Stürme zu den Innertropischen Konvergenzzonen standen. Das klang damals sehr theoretisch. Es brauchte praktische Erfahrung, Poseidon die Locken zu föhnen und einen Gaffelschoner unter vollem Tuch durch einen Wirbelsturm zu steuern. Letztlich war es keine Schande für Momo und Elise, dass ihnen das Schiff immer wieder aus dem Ruder lief. Die Zwei kämpften verzweifelt. Sie brauchten Hilfe. Wir waren zu erschöpft zum Streiten, bargen die Stagsegel, so gut es ging, drehten über das Großsegel bei und fixierten den Baum mit Taljen. Um den Kontakt mit den Meuterern zu vermeiden, blieb ich danach unter Deck, verkeilte mich in der Koje und lauschte den Geräuschen.
Das Schaukeln wurde erträglich. Trotzdem kam weiterhin sehr viel Wasser über, wie in einem schlechten Seeräuberfilm. Momodu lag leergekotzt und fast besinnungslos vor Seekrankheit in der Kammer von Roy, weil man ihn da nicht sehen musste. Hören konnten wir ihn trotzdem. Es war ein höllisches Konzert. Das Rauschen von Wind und Wellen, der prügelnde Donner, das Arbeiten der Holzverbindungen, die Sauggeräusche der Lenzpumpen, die schrille Stimme von Elise, das erbärmliche Würgen unseres shadow-captains, das Getrampel und Momos Geschrei. Da dachte ich: (Ps. 55; 6, 7, 8) Hätte ich Flügel wie eine Taube, ich flöge davon und käme zur Ruhe. Weit fort möchte ich fliehen, die Nacht verbringen in der Wüste. An einen sicheren Ort möchte ich eilen, vor dem Wetter, und vor dem tobenden Sturm.

Provisorisches Logbuch der Golden Harvest:
Montag, 28. Mai 1979
Nach fünf Tagen unter Momos Diktatur erreichen wir Land. Nach all meinen Berechnungen kann es sich nur um Port Gentil handeln. Momo is dangerous insane. Die Maschine ist nicht in Ordnung, Nummer 1 schlägt stark. Ich mache Momo darauf aufmerksam, werde jedoch verhöhnt, dass ich Angst hätte und so weiter. Nach einer Stunde, um 12:00 Uhr, bricht die Maschine zusammen.
Momo ist irre. Ich versuche so diplomatisch und freundlich wie nur möglich zu sein, aber jede Information, die ich gebe, wird mit Demütigung und Beleidigung beantwortet. Er ist nun von der Idee besessen, dass wir uns im Kongo befinden. Totally gone.
Ich peilte die Küste an und versuchte Momo zu erklären, dass wir uns unmöglich im Kongo befinden konnten. Im Kongo gab es keine derartigen Landzungen. Ich zeigte ihm Kap Lopez auf der Karte. Port Gentil in Gabun. Er grunzte ärgerlich und führte das Lineal nach unten, bis es die Halbinsel südlich von Luanda berührte. Elise sollte sich das anschauen. Sie nickte. Die Zwei glaubten nun wieder, Angola erreicht zu haben, und wollten unter Motorkraft Luanda anlaufen. Sie hatten es eilig, starteten Kati, obwohl die Maschine immer noch vor Hitze dampfte. Es roch nach verbranntem Öl. Ich versuchte die Zwei zu bremsen, doch sie verhöhnten mich und gaben volle Kraft voraus. Kati klopfte. Sie kreischte. Das Kühlwasser spritzte aus den Schläuchen. Es gab weder Fett noch Öl.
Provisorisches Logbuch der Golden Harvest:
Trotz meiner stärksten Einwände startet Momo die Maschine.
Nach einer Minute ist sie total zerstört.
Es klang nach Kolbenfresser. Kati Kelvin blieb ruckartig stehen. Sie verreckte mit einem grässlichen Schrei und fing an zu qualmen. Wir flohen an Deck. Das ganze Schiff war eingenebelt vom Todeshauch der Hauptmaschine. Der Rauch kam aus allen Öffnungen, legte sich wie eine graue Wolke über die Golden Harvest. Kati hatte ihren letzten Atemzug getan.
Wir loteten sieben Faden und ließen den Anker fallen. Elise holte Sofakissen an Deck, Momo die Gitarre. Sie machten es sich vorn an Steuerbordseite bequem, da, wo die Nagelbank fehlte und Teile vom Schanzkleid. Ich saß achtern neben dem Ruderhaus, wo ich häufig mit Roy gesessen hatte, schaute zu, wie der Dunst aus dem Schiff aufstieg und schrieb Tagebuch.
Montag, 28. Mai 1979
Nach fünf Tagen unter Momos Diktatur erreichen wir Land. Nach all meinen Berechnungen kann es sich nur um Port Gentil handeln. Momo is dangerous insane. Die Maschine ist nicht in Ordnung, Nummer 1 schlägt stark. Ich mache Momo darauf aufmerksam, werde jedoch verhöhnt, dass ich Angst hätte und so weiter. Nach einer Stunde, um 12:00 Uhr, bricht die Maschine zusammen.
Momo ist irre. Ich versuche so diplomatisch und freundlich wie nur möglich zu sein, aber jede Information, die ich gebe, wird mit Demütigung und Beleidigung beantwortet. Er ist nun von der Idee besessen, dass wir uns im Kongo befinden. Totally gone.
Ich peilte die Küste an und versuchte Momo zu erklären, dass wir uns unmöglich im Kongo befinden konnten. Im Kongo gab es keine derartigen Landzungen. Ich zeigte ihm Kap Lopez auf der Karte. Port Gentil in Gabun. Er grunzte ärgerlich und führte das Lineal nach unten, bis es die Halbinsel südlich von Luanda berührte. Elise sollte sich das anschauen. Sie nickte. Die Zwei glaubten nun wieder, Angola erreicht zu haben, und wollten unter Motorkraft Luanda anlaufen. Sie hatten es eilig, starteten Kati, obwohl die Maschine immer noch vor Hitze dampfte. Es roch nach verbranntem Öl. Ich versuchte die Zwei zu bremsen, doch sie verhöhnten mich und gaben volle Kraft voraus. Kati klopfte. Sie kreischte. Das Kühlwasser spritzte aus den Schläuchen. Es gab weder Fett noch Öl.
Provisorisches Logbuch der Golden Harvest:
Trotz meiner stärksten Einwände startet Momo die Maschine.
Nach einer Minute ist sie total zerstört.
Es klang nach Kolbenfresser. Kati Kelvin blieb ruckartig stehen. Sie verreckte mit einem grässlichen Schrei und fing an zu qualmen. Wir flohen an Deck. Das ganze Schiff war eingenebelt vom Todeshauch der Hauptmaschine. Der Rauch kam aus allen Öffnungen, legte sich wie eine graue Wolke über die Golden Harvest. Kati hatte ihren letzten Atemzug getan.
Wir loteten sieben Faden und ließen den Anker fallen. Elise holte Sofakissen an Deck, Momo die Gitarre. Sie machten es sich vorn an Steuerbordseite bequem, da, wo die Nagelbank fehlte und Teile vom Schanzkleid. Ich saß achtern neben dem Ruderhaus, wo ich häufig mit Roy gesessen hatte, schaute zu, wie der Dunst aus dem Schiff aufstieg und schrieb Tagebuch.

Am Abend setzte mich ein Franzose mit dem Zodiak zur Golden Harvest über. Er nannte den Strandabschnitt, wo wir lagen, »Dajü«. Dort gab es lediglich ein paar Wochenendhäuschen unter den Palmen. Er musste gleich weiter. Keine Zeit: »C’est la vie!«
Ich war endlich wieder allein, konnte in Ruhe nachdenken und angeln. Für Momo und Elise lag das Dingi am Strand, damit ich nicht dauernd horchen musste, ob jemand gegen den Wind rief. Nach zwei Tagen meldete sich erneut der Magen. Durch das Grasrauchen konnte ich den Hunger mit Humor ertragen. Allein der Körper brauchte was Essbares. Es gab jedoch keine Fische in dieser sandigen Bucht, sodass ich schließlich auf die Idee kam, den Anker zu lichten, um den Schoner in bessere Jagdgründe treiben zu lassen, in Richtung Meer, wo leckere Salzwasserfische lebten, die großen Yellowtails und Barsche. Ich konnte sie schon in der Pfanne riechen. Diese Vorstellung brachte mich auf eine noch radikalere Idee.
Ich eilte in die master’s cabin zum Kartenschrank. Der war zwar fast vollständig geplündert, doch eine Karte des tropischen Atlantiks hatten sie übriggelassen. Es gab da eine Strömung mit zwei Knoten Geschwindigkeit. Die lief von Gabun nach Brasilien. Durch Lichten des Ankers würde die Golden Harvest vom Ogowe direkt auf den Südäquatorialstrom gelegt.
Ich errechnete, wie lange es dauern würde, bis der Schoner Brasilien erreichte, wenn ich das Schiff einfach treiben ließ, ohne Maschine und Segel: Zwei Monate durch die Niggerbreiten. Das Boot würde von der Strömung etwa 50 Seemeilen pro Tag westwärts getragen, 90 Kilometer in 24 Stunden. Nach etwa 60 Tagen wären die Inseln im Amazonas-Delta erreicht, wo es noch unberührte Paradiese gab. Es war die Chance, ein neues Leben anzufangen und die alte Identität zu löschen, falls es mir gelänge, auf einer der unbewohnten Inseln zu landen, wie einst die Bounty-Meuterer auf Pitcairn.
Mein Entschluss stand fest. Das einzige Problem blieb der Hunger. Es gab nur noch zehn Liter Wasser an Bord. Ich wusste, worauf ich mich einließ, wollte mich möglichst wenig bewegen, um Energie zu sparen. Die Katzen streiften mir um die Beine. Keine Zeit zum Schmusen. Ich stieg an Deck, um den Anker zu lichten. Die Ebbe hatte bereits eingesetzt und die Kette gespannt.
Meter für Meter näherte sich die Golden Harvest dem Tiefpunkt. Mir wurde schwindelig vor Anstrengung. Zum Schluss kam die Dünung zu Hilfe und hob die Flunken aus dem Grund. Auf einmal ging das Kurbeln leicht.
Ich war endlich wieder allein, konnte in Ruhe nachdenken und angeln. Für Momo und Elise lag das Dingi am Strand, damit ich nicht dauernd horchen musste, ob jemand gegen den Wind rief. Nach zwei Tagen meldete sich erneut der Magen. Durch das Grasrauchen konnte ich den Hunger mit Humor ertragen. Allein der Körper brauchte was Essbares. Es gab jedoch keine Fische in dieser sandigen Bucht, sodass ich schließlich auf die Idee kam, den Anker zu lichten, um den Schoner in bessere Jagdgründe treiben zu lassen, in Richtung Meer, wo leckere Salzwasserfische lebten, die großen Yellowtails und Barsche. Ich konnte sie schon in der Pfanne riechen. Diese Vorstellung brachte mich auf eine noch radikalere Idee.
Ich eilte in die master’s cabin zum Kartenschrank. Der war zwar fast vollständig geplündert, doch eine Karte des tropischen Atlantiks hatten sie übriggelassen. Es gab da eine Strömung mit zwei Knoten Geschwindigkeit. Die lief von Gabun nach Brasilien. Durch Lichten des Ankers würde die Golden Harvest vom Ogowe direkt auf den Südäquatorialstrom gelegt.
Ich errechnete, wie lange es dauern würde, bis der Schoner Brasilien erreichte, wenn ich das Schiff einfach treiben ließ, ohne Maschine und Segel: Zwei Monate durch die Niggerbreiten. Das Boot würde von der Strömung etwa 50 Seemeilen pro Tag westwärts getragen, 90 Kilometer in 24 Stunden. Nach etwa 60 Tagen wären die Inseln im Amazonas-Delta erreicht, wo es noch unberührte Paradiese gab. Es war die Chance, ein neues Leben anzufangen und die alte Identität zu löschen, falls es mir gelänge, auf einer der unbewohnten Inseln zu landen, wie einst die Bounty-Meuterer auf Pitcairn.
Mein Entschluss stand fest. Das einzige Problem blieb der Hunger. Es gab nur noch zehn Liter Wasser an Bord. Ich wusste, worauf ich mich einließ, wollte mich möglichst wenig bewegen, um Energie zu sparen. Die Katzen streiften mir um die Beine. Keine Zeit zum Schmusen. Ich stieg an Deck, um den Anker zu lichten. Die Ebbe hatte bereits eingesetzt und die Kette gespannt.
Meter für Meter näherte sich die Golden Harvest dem Tiefpunkt. Mir wurde schwindelig vor Anstrengung. Zum Schluss kam die Dünung zu Hilfe und hob die Flunken aus dem Grund. Auf einmal ging das Kurbeln leicht.

Die Zukunft sah wieder düster aus, bis sich nach ein paar Stunden eine weiße Plastikyacht aus dem Ogowe-Delta näherte und Kurs auf die Golden Harvest nahm. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl. An Bord waren drei junge Franzosen. Sie wirkten sehr menschlich, sodass ich offen fragte, ob sie afrikanischen Tabak kennen würden.
»Oui, oui!« Na klar!
»Tabac Africain! C’est magnefique!«
Sie hätten so was, ich sollte doch mitkommen.
Es war das Beste, was mir passieren konnte: Einfach verschwinden. Momo und Elise würden sich schon irgendwie abreagieren. Ich zeigte den Jungs kurz das Schiff, servierte den Katzen Futter und steckte ein paar Fotos ein. Wir segelten den Ogowe aufwärts nach Port Gentil. Dort gab es direkt am Strand eine Art Markthalle aus Beton. Oben am Giebel stand das Wort »Marché«.
Der Hafen war eigentlich nur eine Spundwand am Ende einer versandeten Bucht, wo ein paar größere Einbäume lagen und das Dampfboot von dem Käfersammler. Die jungen Franzosen führten mich an der Kathedrale vorbei in ein sehr schönes Stadtviertel. Sie gehörten zu einer Blues-Band, die aus schwarzen und weißen Musikern bestand. Der Drummer, ein kleiner, dicker, freundlicher Gabunese hieß Pascha. Joeman war der Bassist. Er baute riesige Tüten mit normalem Briefpapier und langen Filtern aus Pappe. Danach wurde stundenlang gejammt. Sie hatten eine 60 Watt Anlage und zwei alte E-Gitarren.
Die Golden Harvest lag derweil verlassen am Kap Lopez. Es wäre leicht gewesen, Operation Namibia ein Weilchen zu vergessen, aber die drei wollten natürlich wissen, was es mit dem schwarzen Schiff auf sich hatte, ob noch andere Leute an Bord lebten und was wir so machten. Ich erzählte, dass wir Bücher für die Unterdrückten in Namibia transportierten. Sie wussten nichts von Namibia. Nur Pascha wirkte interessiert, er fragte immer wieder nach den Büchern und wollte mir am nächsten Tag ein paar seiner Freunde vorstellen, die ebenfalls Bücher lesen würden. Er tat sehr geheimnisvoll. Das seien Freunde der okkulten Literatur.
»Oui, oui!« Na klar!
»Tabac Africain! C’est magnefique!«
Sie hätten so was, ich sollte doch mitkommen.
Es war das Beste, was mir passieren konnte: Einfach verschwinden. Momo und Elise würden sich schon irgendwie abreagieren. Ich zeigte den Jungs kurz das Schiff, servierte den Katzen Futter und steckte ein paar Fotos ein. Wir segelten den Ogowe aufwärts nach Port Gentil. Dort gab es direkt am Strand eine Art Markthalle aus Beton. Oben am Giebel stand das Wort »Marché«.
Der Hafen war eigentlich nur eine Spundwand am Ende einer versandeten Bucht, wo ein paar größere Einbäume lagen und das Dampfboot von dem Käfersammler. Die jungen Franzosen führten mich an der Kathedrale vorbei in ein sehr schönes Stadtviertel. Sie gehörten zu einer Blues-Band, die aus schwarzen und weißen Musikern bestand. Der Drummer, ein kleiner, dicker, freundlicher Gabunese hieß Pascha. Joeman war der Bassist. Er baute riesige Tüten mit normalem Briefpapier und langen Filtern aus Pappe. Danach wurde stundenlang gejammt. Sie hatten eine 60 Watt Anlage und zwei alte E-Gitarren.
Die Golden Harvest lag derweil verlassen am Kap Lopez. Es wäre leicht gewesen, Operation Namibia ein Weilchen zu vergessen, aber die drei wollten natürlich wissen, was es mit dem schwarzen Schiff auf sich hatte, ob noch andere Leute an Bord lebten und was wir so machten. Ich erzählte, dass wir Bücher für die Unterdrückten in Namibia transportierten. Sie wussten nichts von Namibia. Nur Pascha wirkte interessiert, er fragte immer wieder nach den Büchern und wollte mir am nächsten Tag ein paar seiner Freunde vorstellen, die ebenfalls Bücher lesen würden. Er tat sehr geheimnisvoll. Das seien Freunde der okkulten Literatur.

Paschas Bücherfreunde wohnten in einem Außenbezirk des Ghettos. Dort war die Natur sehr stark durch Rohöl geschädigt. Anstelle von Straßen gab es nur schlammige Schneisen, an deren abgetrockneten Ufern bunt gekleidete Mammies saßen und über offenen Feuerstellen lecker riechende »Farinas« frittierten, kleine Schmalzkuchen, die in siedendem Fett ausgebacken wurden. Wir teilten uns eine Tüte voll, da wir die »munchies« hatten, diese Lust auf Süßes, die manchmal nach dem Rauchen auftrat. Die heißen Farinas waren genau die richtige Medizin.
Wenig später kamen wir zu einem großen Holzhaus, das zum Schutz vor Hochwasser auf Pfählen gebaut war. Eine schmale Treppe führte zur offenen Veranda, wo auf langen Teppichstreifen mindestens 20 Paar Schuhe ordentlich in einer Reihe standen. Pascha stellte seine Badelatschen daneben. Ich hatte nur den Verband am Fuß. Die Tür zierten magischen Zeichen, von denen eines an ein Ruderrad erinnerte. Pascha wollte mich hier einem ganz besonderen Menschen vorstellen, einem Erleuchteten, einem heiligen Illuminaten.
Ich fand es inzwischen ganz normal, dass man in Afrika überall erleuchtete Menschen mit magischen Fähigkeiten treffen konnte. Dieser Heilige in Port Gentil war jedenfalls ein Freund von Büchern und vermutlich das führende Mitglied einer Rosenkreuzer-Gemeinschaft.
Pascha klopfte zaghaft und wartete, bis jemand öffnete. Wir betraten einen halbverdunkelten Raum, in dessen Mitte ein großes Bett stand, das von den Besitzern der Schuhe auf der Veranda umlagert wurde. Lauter Männer mit ehrfürchtig fragendem Blick. Sie saßen schweigend auf dem Fußboden. Manche im Schneidersitz, andere in der Hocke.
Auf dem Bett thronte in Decken gehüllt der Erleuchtete wie eine erhabene Gottheit. Eine würdevolle Erscheinung trotz der vergammelten Tücher. Er lächelte freundlich, ließ sich nicht weiter stören. Wir sollten uns setzen. Der Logenmeister redete mit den Leuten, und klärte geduldig ihre Fragen. Zwischendurch legten sie Geld auf die Matratze. Dafür erhielten sie afrikanischen Tabak. Kleine Rollen aus Zementsackpapier. Der Mann hatte keine Beine mehr. Was unter der Decke so aussah, war in Wirklichkeit sein Grasvorrat.
Der Erleuchtete wollte wissen, wer ich sei. Pascha stellte mich routiniert als »homme le monde de allemagne« vor, der mit einem Segelschiff voller Bücher vorm Kap Lopez liege. Der Illuminat zeigte sich hocherfreut. Er wollte mit uns allein sprechen. Die anderen wurden zu den Schuhen geschickt. Er zog unter der Decke ein Buch hervor, auf dem wieder dieses magische Signum glänzte. Ich sollte das Symbol betrachten, ob ich es kennen würde? Der Meister musterte mein Gesicht. Er fragte nach französischen Schriften, weil er nur Französisch verstand. Seine Jünger zählten zu den Analphabeten. Sie durften nach 10 Minuten wieder rein kommen und erfahren, dass es an Bord des schwarzen Segelschiffes keine französische Literatur gab. Das wurde allgemein bedauert.
Wenig später kamen wir zu einem großen Holzhaus, das zum Schutz vor Hochwasser auf Pfählen gebaut war. Eine schmale Treppe führte zur offenen Veranda, wo auf langen Teppichstreifen mindestens 20 Paar Schuhe ordentlich in einer Reihe standen. Pascha stellte seine Badelatschen daneben. Ich hatte nur den Verband am Fuß. Die Tür zierten magischen Zeichen, von denen eines an ein Ruderrad erinnerte. Pascha wollte mich hier einem ganz besonderen Menschen vorstellen, einem Erleuchteten, einem heiligen Illuminaten.
Ich fand es inzwischen ganz normal, dass man in Afrika überall erleuchtete Menschen mit magischen Fähigkeiten treffen konnte. Dieser Heilige in Port Gentil war jedenfalls ein Freund von Büchern und vermutlich das führende Mitglied einer Rosenkreuzer-Gemeinschaft.
Pascha klopfte zaghaft und wartete, bis jemand öffnete. Wir betraten einen halbverdunkelten Raum, in dessen Mitte ein großes Bett stand, das von den Besitzern der Schuhe auf der Veranda umlagert wurde. Lauter Männer mit ehrfürchtig fragendem Blick. Sie saßen schweigend auf dem Fußboden. Manche im Schneidersitz, andere in der Hocke.
Auf dem Bett thronte in Decken gehüllt der Erleuchtete wie eine erhabene Gottheit. Eine würdevolle Erscheinung trotz der vergammelten Tücher. Er lächelte freundlich, ließ sich nicht weiter stören. Wir sollten uns setzen. Der Logenmeister redete mit den Leuten, und klärte geduldig ihre Fragen. Zwischendurch legten sie Geld auf die Matratze. Dafür erhielten sie afrikanischen Tabak. Kleine Rollen aus Zementsackpapier. Der Mann hatte keine Beine mehr. Was unter der Decke so aussah, war in Wirklichkeit sein Grasvorrat.
Der Erleuchtete wollte wissen, wer ich sei. Pascha stellte mich routiniert als »homme le monde de allemagne« vor, der mit einem Segelschiff voller Bücher vorm Kap Lopez liege. Der Illuminat zeigte sich hocherfreut. Er wollte mit uns allein sprechen. Die anderen wurden zu den Schuhen geschickt. Er zog unter der Decke ein Buch hervor, auf dem wieder dieses magische Signum glänzte. Ich sollte das Symbol betrachten, ob ich es kennen würde? Der Meister musterte mein Gesicht. Er fragte nach französischen Schriften, weil er nur Französisch verstand. Seine Jünger zählten zu den Analphabeten. Sie durften nach 10 Minuten wieder rein kommen und erfahren, dass es an Bord des schwarzen Segelschiffes keine französische Literatur gab. Das wurde allgemein bedauert.

Pascha kaufte etwas Gras und erzählte von seinem Onkel, einem Flussfischer. Bei dem könne man sich ein paar Zeffa verdienen. Er beschrieb mir den Ort, wo der Onkel wohnte. Ich beschloss, mich ein wenig umzusehen. Port Gentil war ein Reedehafen. Die großen Frachter luden draußen im Fluss ihre Logs. An der Pier lagen nur drei kleine Schlepper, die diese Baumstämme zu den Schiffen bugsierten. Jeder Stamm wurde mit eingeschossenen, bunten Plastikstreifen nummeriert und markiert. Weiter hinten dümpelten Versorger im schlammigen Wasser und die Fähre nach Lambarene. Ich wollte um Arbeit bitten, doch keiner fühlte sich zuständig.
An der Pier gab es einen Holzverschlag mit Alkoholausschank. Ich hoffte, dort ein paar Seeleute zu treffen. Der Wirt schien mich gleich zu verstehen. Ich sollte ihm folgen, er wüsste genau, was ich suche. Er packte meinen Arm und zog mich ins Hinterzimmer, wo ein junges, uriges Vollweib neben einer verschimmelten Matratze hockte. Das sei seine Tochter. Er zwinkerte vielsagend und ließ uns allein. Das Mädchen zeigte glücklich auf ihr Herz: »Rose!« Sie wollte sich etwas Geld verdienen und hob mit beiden Händen die gewaltigen Brüste an:
»Is good?«
Rose war begeistert von den Möpsen. Sie konnte nicht glauben, dass ich so was nicht wollte und selbst einen Job suchte. Sie gab keine Ruhe:
»Is good?«
»Is good?«
Mir fehlten die Worte. Es war zum Heulen. Die Rose von Port Gentil hatte überhaupt nichts von einer Rose. Sie war weich, rund, ganz ohne Stacheln. Die Regeln lagen ihr im Blut. Sie leckte sich stöhnend die Lippen und fing an, den Stuhl zu reiten, auf dem ich saß. Die Möpse sprangen mir ins Gesicht. Sie raubten mir den Atem. Ich schenkte ihr die Fotos von der Golden Harvest, damit sie mich wieder laufen ließ.
Paschas Onkel wohnte im Garten eines reichen Franzosen, in der kleinen hölzernen Gartenlaube neben einem imposanten, abgestorbenen Baum. Zwischen dem ausgebleichten Baumskelett und der Laube standen mehrere Holzstiegen um eine Feuerstelle. Der Onkel saß auf einer der Kisten. Er war damit beschäftigt, Angelhaken an kurzen Tauenden festzuknoten. Wir sollten Platz nehmen und helfen, die Tampen im Abstand von einem Meter an der Fangleine zu befestigen. Pascha fragte, ob er einen Job für mich hätte. Der Onkel bejahte und wollte mir gleich alles beibringen. Die Knoten kannte ich bereits. Die Arbeit machte Spaß. Er nannte für alles die französischen Namen und freute sich über meine Geschicklichkeit.
Am späten Nachmittag wurden die Leinen zusammengerollt und der Außenborder aus der Hütte geholt. Der Onkel trug die Taue. Pascha und ich den schweren Motor. Das Material musste zum Strand gebracht werden, zu der Markthalle aus Beton. Das war ein tropenwettertaugliches, weit überstehendes Betongiebeldach auf vier stabilen Betonstelzen über einer erhöhten Plattform, wie ein antikes Heiligtum. Rund um die Halle standen Verkaufsbuden. Die African Queen lag zwischen großen Pirogen vor der Pier auf Grund. Das Wasser roch nach toten Fischen.
An der Pier gab es einen Holzverschlag mit Alkoholausschank. Ich hoffte, dort ein paar Seeleute zu treffen. Der Wirt schien mich gleich zu verstehen. Ich sollte ihm folgen, er wüsste genau, was ich suche. Er packte meinen Arm und zog mich ins Hinterzimmer, wo ein junges, uriges Vollweib neben einer verschimmelten Matratze hockte. Das sei seine Tochter. Er zwinkerte vielsagend und ließ uns allein. Das Mädchen zeigte glücklich auf ihr Herz: »Rose!« Sie wollte sich etwas Geld verdienen und hob mit beiden Händen die gewaltigen Brüste an:
»Is good?«
Rose war begeistert von den Möpsen. Sie konnte nicht glauben, dass ich so was nicht wollte und selbst einen Job suchte. Sie gab keine Ruhe:
»Is good?«
»Is good?«
Mir fehlten die Worte. Es war zum Heulen. Die Rose von Port Gentil hatte überhaupt nichts von einer Rose. Sie war weich, rund, ganz ohne Stacheln. Die Regeln lagen ihr im Blut. Sie leckte sich stöhnend die Lippen und fing an, den Stuhl zu reiten, auf dem ich saß. Die Möpse sprangen mir ins Gesicht. Sie raubten mir den Atem. Ich schenkte ihr die Fotos von der Golden Harvest, damit sie mich wieder laufen ließ.
Paschas Onkel wohnte im Garten eines reichen Franzosen, in der kleinen hölzernen Gartenlaube neben einem imposanten, abgestorbenen Baum. Zwischen dem ausgebleichten Baumskelett und der Laube standen mehrere Holzstiegen um eine Feuerstelle. Der Onkel saß auf einer der Kisten. Er war damit beschäftigt, Angelhaken an kurzen Tauenden festzuknoten. Wir sollten Platz nehmen und helfen, die Tampen im Abstand von einem Meter an der Fangleine zu befestigen. Pascha fragte, ob er einen Job für mich hätte. Der Onkel bejahte und wollte mir gleich alles beibringen. Die Knoten kannte ich bereits. Die Arbeit machte Spaß. Er nannte für alles die französischen Namen und freute sich über meine Geschicklichkeit.
Am späten Nachmittag wurden die Leinen zusammengerollt und der Außenborder aus der Hütte geholt. Der Onkel trug die Taue. Pascha und ich den schweren Motor. Das Material musste zum Strand gebracht werden, zu der Markthalle aus Beton. Das war ein tropenwettertaugliches, weit überstehendes Betongiebeldach auf vier stabilen Betonstelzen über einer erhöhten Plattform, wie ein antikes Heiligtum. Rund um die Halle standen Verkaufsbuden. Die African Queen lag zwischen großen Pirogen vor der Pier auf Grund. Das Wasser roch nach toten Fischen.

Paschas Onkel ging voraus durch den Schlamm, zu einem dieser fünf Meter langen Boote. Wir schraubten den Außenborder fest, zogen den Kahn ins tiefe Wasser und fuhren unter Motorkraft den Ogowe stromaufwärts.
Der Onkel hockte im Bug und gab Pascha mit Handzeichen Kommandos. Der Drummer saß achtern an der Maschine. Die Haltung war unbequem. Es gab keine Duchten, keine Bänke. Pascha steuerte verschiedene Buschdörfer an, um Waren zu tauschen. Das Ufer des Ogowe war stellenweise so flach, dass wir manchmal 100 Meter vom Strand entfernt lagen, weil der Einbaum bereits den Grund berührte. Der Onkel ging dann den Rest zu Fuß, während ich mit Pascha im Boot wartete und dem Urwaldsound lauschte. In der Nähe des Ufers roch es nach Lagerfeuer und Gewürzen. Die Farben des Regenwaldes leuchteten in der Abendsonne: Das gelbe Wasser, der grüne Wald und der rote Boden, der überall dort sichtbar wurde, wo Menschen am Ufer wohnten.
Kurz vor Sonnenuntergang herrschte eine magische Stimmung auf dem Fluss. Fische sprangen aus dem Wasser, um sich bunte Libellen zu fangen. Wir hätten gerne etwas geraucht, doch der Alte hatte uns das Rauchen verboten. Pascha fuhr zu den Fischgründen des Onkels, wo der Ogowe so breit wurde, dass man das Ufer kaum noch erkennen konnte. Die Ochsenfrösche klangen wie fernes Donnergrollen. Sie quakten bis tief in die Nacht, während der Alte die Leinen auslegte. Wir paddelten, bis alle Enden mit Bojen markiert waren. Der Onkel warf zufrieden den Anker.
Als nächstes hieß es regungslos warten. Ein Härtetest. Ich war froh, wenn wir alle paar Stunden an der Fangleine entlang paddeln durften. Paschas Onkel nahm dann die Fische von den Haken und befestigte neue Köder. Dazu mussten wir die Piroge auf einem Punkt in der Strömung halten. Eine angenehme Arbeit, die von der Kälte ablenkte und den ekligen Grundfischen, die sich nach und nach im Einbaum ansammelten.
Im Boot stand sehr viel Wasser, aber das sollte wohl so sein, um die gefangenen Tiere frisch zu halten. Den gefährlichen Stachelrochen brach der Onkel mit einer geschickten Handbewegung den Stachel ab, bevor sie vor unseren Füßen landeten. Sie zappelten um ihr Leben. Ich saß bis zur Hüfte in der Brühe und hatte direkten Körperkontakt mit den verletzten Flussbewohnern. Die Sache gefiel mir nicht, das Warten am Anker, mit dem Herzen auf Normal Null, umgeben von Todgeweihten, die nur deshalb nicht erlöst wurden, weil sie »just in time« verrecken sollten.
Der Onkel schlief im Sitzen ein, Pascha ebenfalls. Ich lauschte aufgeregt und nahm alles um mich herum wahr. Das Schlagen und Schnappen der pikierten Kaltblüter und das gleichmäßige Gurgeln der Strömung. Manchmal kam ein Schrei aus dem Urwald. Catfische stiegen auf, angelockt vom glänzenden Mondlicht. Der Geist der Göttin schwebte über dem Wasser.
Der Onkel hockte im Bug und gab Pascha mit Handzeichen Kommandos. Der Drummer saß achtern an der Maschine. Die Haltung war unbequem. Es gab keine Duchten, keine Bänke. Pascha steuerte verschiedene Buschdörfer an, um Waren zu tauschen. Das Ufer des Ogowe war stellenweise so flach, dass wir manchmal 100 Meter vom Strand entfernt lagen, weil der Einbaum bereits den Grund berührte. Der Onkel ging dann den Rest zu Fuß, während ich mit Pascha im Boot wartete und dem Urwaldsound lauschte. In der Nähe des Ufers roch es nach Lagerfeuer und Gewürzen. Die Farben des Regenwaldes leuchteten in der Abendsonne: Das gelbe Wasser, der grüne Wald und der rote Boden, der überall dort sichtbar wurde, wo Menschen am Ufer wohnten.
Kurz vor Sonnenuntergang herrschte eine magische Stimmung auf dem Fluss. Fische sprangen aus dem Wasser, um sich bunte Libellen zu fangen. Wir hätten gerne etwas geraucht, doch der Alte hatte uns das Rauchen verboten. Pascha fuhr zu den Fischgründen des Onkels, wo der Ogowe so breit wurde, dass man das Ufer kaum noch erkennen konnte. Die Ochsenfrösche klangen wie fernes Donnergrollen. Sie quakten bis tief in die Nacht, während der Alte die Leinen auslegte. Wir paddelten, bis alle Enden mit Bojen markiert waren. Der Onkel warf zufrieden den Anker.
Als nächstes hieß es regungslos warten. Ein Härtetest. Ich war froh, wenn wir alle paar Stunden an der Fangleine entlang paddeln durften. Paschas Onkel nahm dann die Fische von den Haken und befestigte neue Köder. Dazu mussten wir die Piroge auf einem Punkt in der Strömung halten. Eine angenehme Arbeit, die von der Kälte ablenkte und den ekligen Grundfischen, die sich nach und nach im Einbaum ansammelten.
Im Boot stand sehr viel Wasser, aber das sollte wohl so sein, um die gefangenen Tiere frisch zu halten. Den gefährlichen Stachelrochen brach der Onkel mit einer geschickten Handbewegung den Stachel ab, bevor sie vor unseren Füßen landeten. Sie zappelten um ihr Leben. Ich saß bis zur Hüfte in der Brühe und hatte direkten Körperkontakt mit den verletzten Flussbewohnern. Die Sache gefiel mir nicht, das Warten am Anker, mit dem Herzen auf Normal Null, umgeben von Todgeweihten, die nur deshalb nicht erlöst wurden, weil sie »just in time« verrecken sollten.
Der Onkel schlief im Sitzen ein, Pascha ebenfalls. Ich lauschte aufgeregt und nahm alles um mich herum wahr. Das Schlagen und Schnappen der pikierten Kaltblüter und das gleichmäßige Gurgeln der Strömung. Manchmal kam ein Schrei aus dem Urwald. Catfische stiegen auf, angelockt vom glänzenden Mondlicht. Der Geist der Göttin schwebte über dem Wasser.

Ich kaufte Obst und afrikanischen Tabak, und wanderte zurück nach Dajü. Als Flussfischer wollte ich nicht noch einmal arbeiten. Dann schon lieber den Hunger ertragen, und Momo und Elise. Die beiden mussten inzwischen gemerkt haben, dass der Schoner weiter draußen lag, als gewöhnlich. Das Dingi war nicht zu sehen. Ich brüllte gegen den Wind, anderthalb Stunden lang. Es wurde dunkel. Sie hörten mich nicht.
Am Strand fand ich schließlich einen Fischer, der vor seiner Hütte am Feuer saß. Ein freundlicher alter Gabunese. Ich zeigte zur Golden Harvest und machte Paddelbewegungen. Der Mann fragte, was er dafür bekäme. Er wollte weder mein Obst, noch afrikanischen Tabak. Also versprach ich ihm ein Buch. Er schien ein Interesse an Büchern zu haben, obwohl ihm Geld sicher lieber gewesen wäre. Ein Buch, das sei interessant, ja, das sei in Ordnung. Er würde mich morgen fahren. Heute nicht mehr: »Demain!« Ich durfte in seiner Hütte schlafen.
Zum Sonnenaufgang saß der Alte immer noch am Feuer. Er bot mir Tee an und sprach mit strahlenden Augen von dem Buch, das er nun bald bekommen sollte. Ein gutes Buch: »Un bon livre!« Ein Buch mit Raffinesse. Seine Begeisterung für Literatur wurde mir langsam unheimlich. Erst als wir im Einbaum saßen ging mir auf, dass er wohl etwas missverstanden hatte. Den geilen Blick kannte ich noch von den Schauerleuten in Apapa. Der wollte Pornos, die heimliche Währung der Dritten Welt. Wie sollte ich den Meuterern verständlich machen, dass ich ein Pornoheft brauchte, um dem Mann sein Entgegenkommen zu bezahlen? Der schöpfte auch gleich Verdacht und folgte mir spontan an Bord, runter in die Mannschaftsmesse.
Momo und Elise waren stinkig, konnten sich jedoch nicht gehen lassen. Ich musste mich rechtfertigen und erklären, was dem Mann zustand. Elise wollte das regeln. In der master’s cabin zog sie aus einer der Kisten ein Buch und drückte es dem Opa in die Hand. Der Leineneinband war angeschimmelt. Die Stirn des Fischers wurde faltig. Er blätterte kurz durch und fühlte sich sofort betrogen, weil er keine Bilder fand. Der Greis fing an zu gestikulieren und zu erzählen, was er alles getan hätte. Er sei die ganze Strecke gerudert, den weiten Weg vom Strand bis hierher. Ich legte einen Hemingway drauf. Da waren auch keine Fotos drin. Der alte Mann fluchte zornig. Er verließ wutentbrannt das Schiff und paddelte zeternd davon: Die Welt sei schlecht. Man könne niemandem trauen: »Merde! Putain!« Seine Flüche wurden vom Wind zu uns herüber getragen.
Am Strand fand ich schließlich einen Fischer, der vor seiner Hütte am Feuer saß. Ein freundlicher alter Gabunese. Ich zeigte zur Golden Harvest und machte Paddelbewegungen. Der Mann fragte, was er dafür bekäme. Er wollte weder mein Obst, noch afrikanischen Tabak. Also versprach ich ihm ein Buch. Er schien ein Interesse an Büchern zu haben, obwohl ihm Geld sicher lieber gewesen wäre. Ein Buch, das sei interessant, ja, das sei in Ordnung. Er würde mich morgen fahren. Heute nicht mehr: »Demain!« Ich durfte in seiner Hütte schlafen.
Zum Sonnenaufgang saß der Alte immer noch am Feuer. Er bot mir Tee an und sprach mit strahlenden Augen von dem Buch, das er nun bald bekommen sollte. Ein gutes Buch: »Un bon livre!« Ein Buch mit Raffinesse. Seine Begeisterung für Literatur wurde mir langsam unheimlich. Erst als wir im Einbaum saßen ging mir auf, dass er wohl etwas missverstanden hatte. Den geilen Blick kannte ich noch von den Schauerleuten in Apapa. Der wollte Pornos, die heimliche Währung der Dritten Welt. Wie sollte ich den Meuterern verständlich machen, dass ich ein Pornoheft brauchte, um dem Mann sein Entgegenkommen zu bezahlen? Der schöpfte auch gleich Verdacht und folgte mir spontan an Bord, runter in die Mannschaftsmesse.
Momo und Elise waren stinkig, konnten sich jedoch nicht gehen lassen. Ich musste mich rechtfertigen und erklären, was dem Mann zustand. Elise wollte das regeln. In der master’s cabin zog sie aus einer der Kisten ein Buch und drückte es dem Opa in die Hand. Der Leineneinband war angeschimmelt. Die Stirn des Fischers wurde faltig. Er blätterte kurz durch und fühlte sich sofort betrogen, weil er keine Bilder fand. Der Greis fing an zu gestikulieren und zu erzählen, was er alles getan hätte. Er sei die ganze Strecke gerudert, den weiten Weg vom Strand bis hierher. Ich legte einen Hemingway drauf. Da waren auch keine Fotos drin. Der alte Mann fluchte zornig. Er verließ wutentbrannt das Schiff und paddelte zeternd davon: Die Welt sei schlecht. Man könne niemandem trauen: »Merde! Putain!« Seine Flüche wurden vom Wind zu uns herüber getragen.

Die Kammer teilte ich mir mit einem jungen Mann aus Ghana. Wir waren von Anfang an Freunde. Victor wohnte in Moské, dem Moscheenviertel von Port Gentil, bei Leuten aus seiner Heimat. Er arbeitete für 5 Dollar pro Tag auf der Sampson Service, solange das Schiff in Gabun stationiert war. Wir lagen regelmäßig in Port Gentil. Er stellte mich seinen Mitbewohnern vor, Peter und Ian. Sie hatten einen schwarzen Kater, »Black Power«, und eine Katze mit fünf jungen, den Kindern von Black Power.
Zwei Wochen nachdem ich an Bord kam, wurde Victor grundlos gefeuert. Zum Trost lud ich ihn auf mein Lieblingswrack. 500 Meter westlich der Pier lag ein zerschossenes Landungsboot halb versunken am Strand des Ogowe. Im Kettenkasten für die Landungsklappe klaffte ein großes Loch. Innen gab es eine erhöhte Plattform, etwa fünf Quadratmeter Fläche. Ein kühler, schattiger Ort der Stille, mein heimliches Exil, wo ich von oben herab den Krabben beim Fressen zuschaute, ohne selbst gesehen zu werden. Der einzige Schmuck war eine Blumenvase, die ich bei jedem Besuch mit selbstgepflückten Pflanzen füllte. Victor konnte damit nichts anfangen. Mein Lieblingsplatz irritierte ihn. Er wollte nach Hause. Ich sollte ihn am nächsten Tag im Moscheenviertel besuchen.
Zwei Wochen nachdem ich an Bord kam, wurde Victor grundlos gefeuert. Zum Trost lud ich ihn auf mein Lieblingswrack. 500 Meter westlich der Pier lag ein zerschossenes Landungsboot halb versunken am Strand des Ogowe. Im Kettenkasten für die Landungsklappe klaffte ein großes Loch. Innen gab es eine erhöhte Plattform, etwa fünf Quadratmeter Fläche. Ein kühler, schattiger Ort der Stille, mein heimliches Exil, wo ich von oben herab den Krabben beim Fressen zuschaute, ohne selbst gesehen zu werden. Der einzige Schmuck war eine Blumenvase, die ich bei jedem Besuch mit selbstgepflückten Pflanzen füllte. Victor konnte damit nichts anfangen. Mein Lieblingsplatz irritierte ihn. Er wollte nach Hause. Ich sollte ihn am nächsten Tag im Moscheenviertel besuchen.

Viktor meinte, man sollte sich zur Feier meines Besuches etwas Besonderes gönnen. Eine Überraschung. Alle fanden das gut. Wir warfen unser Geld zusammen und zogen los. Vor der Bar mieteten die Freunde ein Taxi. Sie baten den Kutscher, langsam durch die Nebenstraßen zu fahren. Victor saß vorn. Die Fenster standen offen. Es war angenehm, im frischen Fahrtwind auszuruhen. Das Radio plärrte orientalische Lieder. Draußen rief ein Muezzin. Die Luft roch nach Gewürzen.
Im Schatten der Mülltonnen am Straßenrand döste ein fetter weißer Kater. Victor brüllte plötzlich »Stopp!«, zog die Handbremse und hechtete mit einem Satz aus dem Wagen. Es gab Tumult. Frauen liefen schreiend davon. Die Autos hinter uns fingen an zu hupen. Bevor der Fahrer begriff was geschah, saß Victor wieder neben ihm, den weißen Kater im Würgegriff.
Der driver wechselte die Farbe und sprang fluchend ins Freie. Alle starrten auf Victor, der das tobende Tier, mit der linken Hand um Kopf und Vorderpfoten, und der rechten um die Hinterpfoten, kräftig auseinanderzog, damit es ihn nicht verletzte. Der Kater stand kurz davor durch zu drehen. Er fauchte zornig.
Peter und Ian überzeugten den Besitzer der Droschke, dass es besser für ihn war zu fahren. Sie brüllten ihn an. Victor schwitzte. Der Kater zeigte die Zähne. Der Kutscher fuhr zitternd los, wobei er nicht aufhörte, Victor zu beschwören, die Bestie bloß gut festzuhalten. Er wimmerte, bekreuzigte sich und brachte den Wagen mit quietschenden Reifen vor der Bar zum Stehen. Er wollte kein Geld. Nicht von solchen Leuten: »Merde!«Wir sollten ihn in Ruhe lassen, einfach verschwinden, zum Teufel:
»Allez au diable!«
Ich folgte den Freunden zum Yellow-House. Victor hatte Schwierigkeiten, den Zimmertiger zu bändigen. Man roch die Panik der Kreatur. Ian schloss die Fensterläden. Er setzte Black Power vor die Tür. Es ging um Leben und Tod. Peter kam mit einem Bottich voll Wasser aus der Kochecke:
»Schnell Bruder, hier!«
Der Kater wollte leben. Er wehrte sich fauchend und spreizte die Zehen, als er kopfüber in den Eimer gestülpt wurde. Ein schrecklicher Kampf. In Lomé hatte mir Roy von einer Südseeinsel erzählt, wo es tabu war, Blut zu vergießen. Dort führten sie die Tiere zum Sterben an den Strand.
Wir standen gebannt um die Pütz, bis der Kater schlapp machte und ausgeblutet werden konnte. Eine Delikatesse! Sie zogen ihm zu dritt das weiße Fell über die Ohren und schabten sorgfältig das Fett von den Muskeln. Die Pfoten blieben am Balg. Der Schädel kam in die Suppe. Sie waren wie verrückt danach. Der Kopf sei das Beste am Kater. Sie wollten dem Geist des Tieres die Reverenz erweisen: »Face to face!« Von Angesicht zu Angesicht.
Im Schatten der Mülltonnen am Straßenrand döste ein fetter weißer Kater. Victor brüllte plötzlich »Stopp!«, zog die Handbremse und hechtete mit einem Satz aus dem Wagen. Es gab Tumult. Frauen liefen schreiend davon. Die Autos hinter uns fingen an zu hupen. Bevor der Fahrer begriff was geschah, saß Victor wieder neben ihm, den weißen Kater im Würgegriff.
Der driver wechselte die Farbe und sprang fluchend ins Freie. Alle starrten auf Victor, der das tobende Tier, mit der linken Hand um Kopf und Vorderpfoten, und der rechten um die Hinterpfoten, kräftig auseinanderzog, damit es ihn nicht verletzte. Der Kater stand kurz davor durch zu drehen. Er fauchte zornig.
Peter und Ian überzeugten den Besitzer der Droschke, dass es besser für ihn war zu fahren. Sie brüllten ihn an. Victor schwitzte. Der Kater zeigte die Zähne. Der Kutscher fuhr zitternd los, wobei er nicht aufhörte, Victor zu beschwören, die Bestie bloß gut festzuhalten. Er wimmerte, bekreuzigte sich und brachte den Wagen mit quietschenden Reifen vor der Bar zum Stehen. Er wollte kein Geld. Nicht von solchen Leuten: »Merde!«Wir sollten ihn in Ruhe lassen, einfach verschwinden, zum Teufel:
»Allez au diable!«
Ich folgte den Freunden zum Yellow-House. Victor hatte Schwierigkeiten, den Zimmertiger zu bändigen. Man roch die Panik der Kreatur. Ian schloss die Fensterläden. Er setzte Black Power vor die Tür. Es ging um Leben und Tod. Peter kam mit einem Bottich voll Wasser aus der Kochecke:
»Schnell Bruder, hier!«
Der Kater wollte leben. Er wehrte sich fauchend und spreizte die Zehen, als er kopfüber in den Eimer gestülpt wurde. Ein schrecklicher Kampf. In Lomé hatte mir Roy von einer Südseeinsel erzählt, wo es tabu war, Blut zu vergießen. Dort führten sie die Tiere zum Sterben an den Strand.
Wir standen gebannt um die Pütz, bis der Kater schlapp machte und ausgeblutet werden konnte. Eine Delikatesse! Sie zogen ihm zu dritt das weiße Fell über die Ohren und schabten sorgfältig das Fett von den Muskeln. Die Pfoten blieben am Balg. Der Schädel kam in die Suppe. Sie waren wie verrückt danach. Der Kopf sei das Beste am Kater. Sie wollten dem Geist des Tieres die Reverenz erweisen: »Face to face!« Von Angesicht zu Angesicht.

Anfang September lagen wir erneut in Port Gentil. Am Wochenende gab es keine Charter. Ich wanderte nach Dajü, um auf der Golden Harvest die Bilgen zu lenzen und die Katzen zu füttern. Der Himmel zeigte sich bedeckt. Das Wetter schwankte. Kleine Windhosen fegten über den Ogowe. Das Dingi lag bis zum Rand voll Regenwasser am Strand hinter einer Palme. Hans musste seit Tagen unterwegs sein. Ich machte mir Sorgen, lenzte hastig das Boot. Der Schoner am Horizont wirkte düster und abweisend
Nachdem die Untiefen hinter mir lagen, erfasste der Ebbstrom das Dingi und zog es zur Golden Harvest. Je näher ich kam, desto stärker wurde das Gefühl, immer tiefer in das in das Zentrum eines unsichtbaren Strudels zu geraten. Ich hatte beim Pullen das Schiff im Rücken und fühlte mich von Bord aus beobachtet. An Deck war niemand zu sehen. Ich rief »Hello«, um mir Mut zu machen, schaute vorsichtig durch die Speigatten, stieg an Deck und lauschte den Geräuschen. Die Stagsegel flatterten lose im Wind. Das Großsegel hatte die Farbenbox unter sich begraben. Neben dem shit bucket lag Roots. Grey One saß mit angelegten Ohren im Schatten des Ruderhauses, leckte sich die Pfoten und maunzte. Die Planken vorm Niedergang waren blutverschmiert. Aus den Windhutzen drangen Klagelaute. Ich meinte, die Stimme von Elise zu hören, und rief in Panik:
»Momo? Elise?«
»Anybody home?«
Keine Antwort. Über dem Regenwald im Südosten türmten sich schwarze Wolken auf. Ich laschte eilig die Segel fest. Hinter dem Fockmast lag der Flügel einer Möwe. Weiter achtern der blutige Kopf. Die Bilder weckten verdrängte Gefühle, ein unbeschreibliches Grauen. Mein Herz raste, seit ich den Schoner betreten hatte. Es kostete Kraft, die Luken zu öffnen.
Unter Deck lagen Bücher und Zeitschriften am Boden verstreut. Kaputte Kisten. Die Kakerlaken beherrschten das Feld. Alles wirkte filzig und schmierig. Auf dem Tisch klebte ein neues Rundschreiben der PNAG. Jemand musste vor kurzem hier gewesen sein. Der Topf mit den Bohnen war noch heiß. Ich durchstreifte das Schiff, verschaffte mir einen Überblick. Bis auf zwei Dosen Tunfisch und einen Eimer voll Hülsenfrüchte gab es nichts mehr zu essen, nichts zu trinken. Der Proviant war verbraucht, die Batterien restlos erschöpft. Das Voltmeter stand unter Null. Der Dieseltank leer. Es gab weder Kerosin noch Petroleum für die Lampen, kein Licht, nicht einmal Kerzen.
In der Kombüse wurde es dunkel. Draußen ging das Gewitter los. Ich stand da, umzingelt von sieben jaulenden Katzen. Die grellen Blitze erinnerten mich an die schwimmenden Leichen, den Horror von Principe. Die erlebte Gewalt war gegenwärtig, jeder Flecken des Schiffes entweiht. Aus den Bilgen stieg penetranter Verwesungsgeruch.
Ich servierte den Katzen die letzten zwei Dosen Tunfisch und blieb unter dem skylight stehen, um im Lichtschein der Blitze den PNAG Bericht zu lesen. Am 15. August (1979) hatte es in London ein Meeting gegeben. Die Nachricht umfasste zwei Listen. Eine mit Punkten, die gut gegangen waren und eine mit Dingen, die besser hätten laufen können. Auf der Positivliste stand 20-mal PNAG, 2-mal GH und einmal die Fri. Die Crew habe in Mozambique interessante Kontakte geknüpft.
PNAG stand blendend da. Sie seien die einzige Gruppe in den USA, die an Namibia arbeite. Dass Ken durch die Aktion in Gabun seine Sprachkenntnisse erweitern konnte, war ein weiterer Pluspunkt, ebenso die Liebe zwischen Roy und Maggie, sowie die Geburt von Anna. Den letzten und wichtigsten Punkt für die PNAG musste ich dreimal lesen, um ihn glauben zu können. Da stand: »Lots of good stuff to eat – ice cream!« Es habe viele gute Sachen zu essen gegeben, zum Beispiel Eiscreme. Eigentlich war Operation Namibia ein Erfolg. Sie hatten alles richtig gemacht. Wir hätten mehr auf sie hören sollen.
In der Negativliste wurde uns noch mal unbewusster Elitismus, Rassismus und Sexismus vorgeworfen, zudem politische Naivität. Jedes Crewmitglied hätte zwei Sprachen beherrschen müssen. Es wäre hilfreich gewesen, wenn wir mit einer realistischeren Einschätzung der politischen Situation in Afrika an die Sache herangegangen wären. Roy und Maggie hätten Baby Anna erst nach dem Tag der Entscheidung in Walvis Bay empfangen dürfen.
Zu jedem der Punkte blitzte es heftig, gefolgt von röhrendem Donnergrollen. Dicke Regentropfen knallten an Deck. Sturmböen jagten das Schiff um den Anker. Die Katzen jaulten. Im Kabelgatt schlug die Kette gegen den Stutzen. Jemand rumorte in der master’s cabin. Die Tür sprang auf. Ich hörte Schritte, stürzte an Deck und verließ fluchtartig das Schiff, ignorierte die Gesichte. Rund um den Schoner lagen silbrig schimmernde Karavellen mit Kreuzen auf den Segeln. Im nächsten Moment verschwanden sie.
Die Rückfahrt dauerte fast eine Stunde, gegen den Wind, gegen den Ebbstrom und gegen jegliche Vernunft, bei einem so starken Gewitter im Dingi zu sitzen. Die Golden Harvest ließ mich nicht los, sie wurde nur langsam kleiner, ergraute im Regen. Sie war zu einem Totenschiff verkommen, beladen mit unerlösten Erinnerungen. Wie konnte Hans das aushalten, falls er überhaupt noch lebte? Der verdammte Verwesungsgeruch und die Geräusche. Ich hatte Elise an Bord gesehen, im Lichtschein der Blitze, für den Bruchteil einer Sekunde. Sie stand an der Spüle, bekleidet mit einem Leichenhemd.
Nachdem die Untiefen hinter mir lagen, erfasste der Ebbstrom das Dingi und zog es zur Golden Harvest. Je näher ich kam, desto stärker wurde das Gefühl, immer tiefer in das in das Zentrum eines unsichtbaren Strudels zu geraten. Ich hatte beim Pullen das Schiff im Rücken und fühlte mich von Bord aus beobachtet. An Deck war niemand zu sehen. Ich rief »Hello«, um mir Mut zu machen, schaute vorsichtig durch die Speigatten, stieg an Deck und lauschte den Geräuschen. Die Stagsegel flatterten lose im Wind. Das Großsegel hatte die Farbenbox unter sich begraben. Neben dem shit bucket lag Roots. Grey One saß mit angelegten Ohren im Schatten des Ruderhauses, leckte sich die Pfoten und maunzte. Die Planken vorm Niedergang waren blutverschmiert. Aus den Windhutzen drangen Klagelaute. Ich meinte, die Stimme von Elise zu hören, und rief in Panik:
»Momo? Elise?«
»Anybody home?«
Keine Antwort. Über dem Regenwald im Südosten türmten sich schwarze Wolken auf. Ich laschte eilig die Segel fest. Hinter dem Fockmast lag der Flügel einer Möwe. Weiter achtern der blutige Kopf. Die Bilder weckten verdrängte Gefühle, ein unbeschreibliches Grauen. Mein Herz raste, seit ich den Schoner betreten hatte. Es kostete Kraft, die Luken zu öffnen.
Unter Deck lagen Bücher und Zeitschriften am Boden verstreut. Kaputte Kisten. Die Kakerlaken beherrschten das Feld. Alles wirkte filzig und schmierig. Auf dem Tisch klebte ein neues Rundschreiben der PNAG. Jemand musste vor kurzem hier gewesen sein. Der Topf mit den Bohnen war noch heiß. Ich durchstreifte das Schiff, verschaffte mir einen Überblick. Bis auf zwei Dosen Tunfisch und einen Eimer voll Hülsenfrüchte gab es nichts mehr zu essen, nichts zu trinken. Der Proviant war verbraucht, die Batterien restlos erschöpft. Das Voltmeter stand unter Null. Der Dieseltank leer. Es gab weder Kerosin noch Petroleum für die Lampen, kein Licht, nicht einmal Kerzen.
In der Kombüse wurde es dunkel. Draußen ging das Gewitter los. Ich stand da, umzingelt von sieben jaulenden Katzen. Die grellen Blitze erinnerten mich an die schwimmenden Leichen, den Horror von Principe. Die erlebte Gewalt war gegenwärtig, jeder Flecken des Schiffes entweiht. Aus den Bilgen stieg penetranter Verwesungsgeruch.
Ich servierte den Katzen die letzten zwei Dosen Tunfisch und blieb unter dem skylight stehen, um im Lichtschein der Blitze den PNAG Bericht zu lesen. Am 15. August (1979) hatte es in London ein Meeting gegeben. Die Nachricht umfasste zwei Listen. Eine mit Punkten, die gut gegangen waren und eine mit Dingen, die besser hätten laufen können. Auf der Positivliste stand 20-mal PNAG, 2-mal GH und einmal die Fri. Die Crew habe in Mozambique interessante Kontakte geknüpft.
PNAG stand blendend da. Sie seien die einzige Gruppe in den USA, die an Namibia arbeite. Dass Ken durch die Aktion in Gabun seine Sprachkenntnisse erweitern konnte, war ein weiterer Pluspunkt, ebenso die Liebe zwischen Roy und Maggie, sowie die Geburt von Anna. Den letzten und wichtigsten Punkt für die PNAG musste ich dreimal lesen, um ihn glauben zu können. Da stand: »Lots of good stuff to eat – ice cream!« Es habe viele gute Sachen zu essen gegeben, zum Beispiel Eiscreme. Eigentlich war Operation Namibia ein Erfolg. Sie hatten alles richtig gemacht. Wir hätten mehr auf sie hören sollen.
In der Negativliste wurde uns noch mal unbewusster Elitismus, Rassismus und Sexismus vorgeworfen, zudem politische Naivität. Jedes Crewmitglied hätte zwei Sprachen beherrschen müssen. Es wäre hilfreich gewesen, wenn wir mit einer realistischeren Einschätzung der politischen Situation in Afrika an die Sache herangegangen wären. Roy und Maggie hätten Baby Anna erst nach dem Tag der Entscheidung in Walvis Bay empfangen dürfen.
Zu jedem der Punkte blitzte es heftig, gefolgt von röhrendem Donnergrollen. Dicke Regentropfen knallten an Deck. Sturmböen jagten das Schiff um den Anker. Die Katzen jaulten. Im Kabelgatt schlug die Kette gegen den Stutzen. Jemand rumorte in der master’s cabin. Die Tür sprang auf. Ich hörte Schritte, stürzte an Deck und verließ fluchtartig das Schiff, ignorierte die Gesichte. Rund um den Schoner lagen silbrig schimmernde Karavellen mit Kreuzen auf den Segeln. Im nächsten Moment verschwanden sie.
Die Rückfahrt dauerte fast eine Stunde, gegen den Wind, gegen den Ebbstrom und gegen jegliche Vernunft, bei einem so starken Gewitter im Dingi zu sitzen. Die Golden Harvest ließ mich nicht los, sie wurde nur langsam kleiner, ergraute im Regen. Sie war zu einem Totenschiff verkommen, beladen mit unerlösten Erinnerungen. Wie konnte Hans das aushalten, falls er überhaupt noch lebte? Der verdammte Verwesungsgeruch und die Geräusche. Ich hatte Elise an Bord gesehen, im Lichtschein der Blitze, für den Bruchteil einer Sekunde. Sie stand an der Spüle, bekleidet mit einem Leichenhemd.